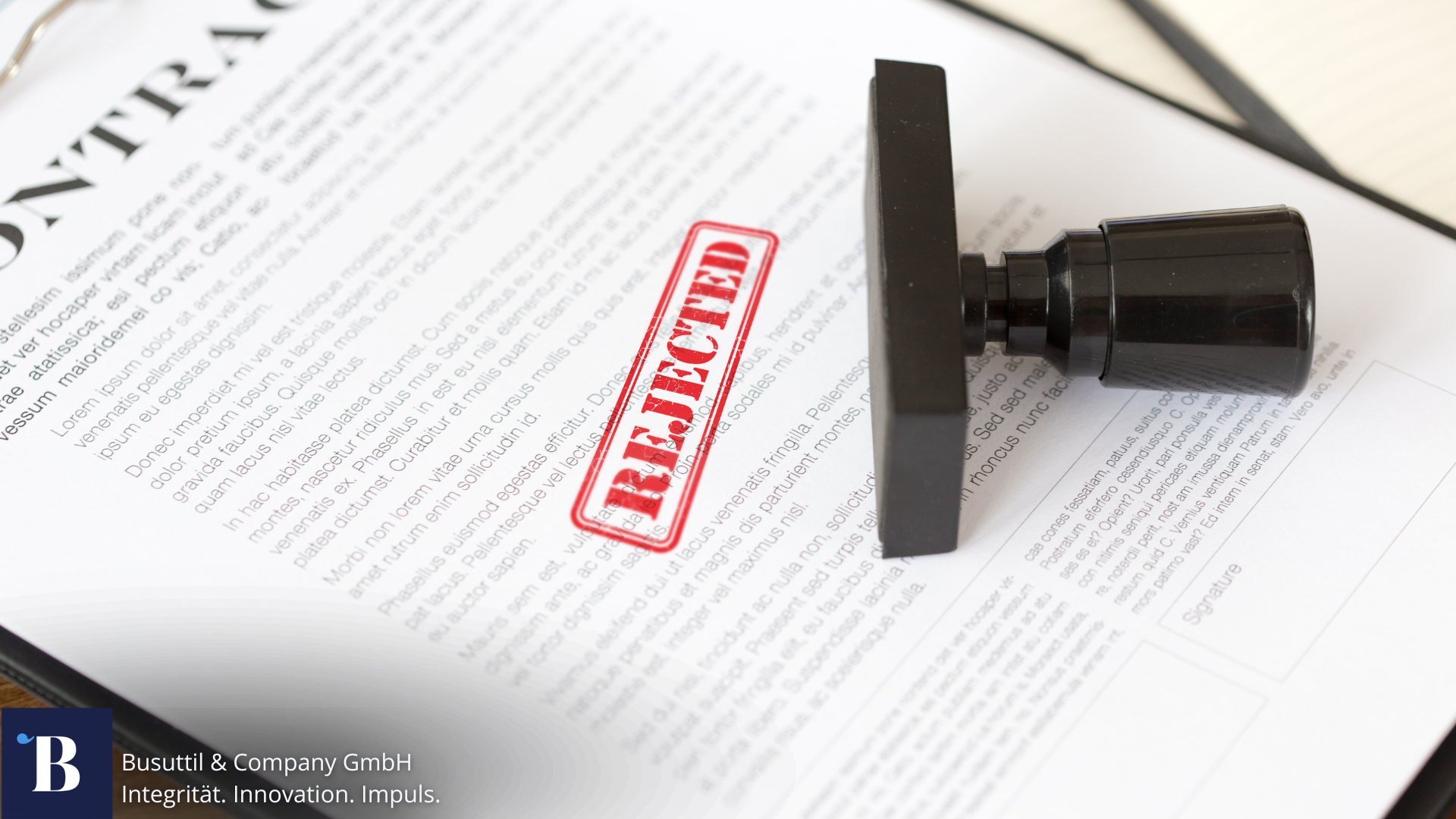Maschinenbau
Die vierte industrielle Revolution und die digitale Transformation zwingen den deutschen Maschinenbau zu Umwandelungen in der Fertigungs- und Produktionstechnik. Durch die Forschungszulage können Sie neue Technologien und Prozesse entwickeln, die effizienter, ressourcenschonender und nachhaltiger sind.
Die Forschungszulage im Maschinenbau: Innovationen der Zukunft
Wussten Sie, dass zahlreiche Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich neuer Technologien, insbesondere im Maschinenbau, für die Forschungszulage in Betracht kommen?
Der Maschinenbausektor durchläuft eine bemerkenswerte Transformation mit exponentiellen Veränderungen, wodurch die Komplexität für viele Unternehmen zu einer täglichen Herausforderung wird. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, eine strategische Innovationsstrategie zu verfolgen. Als Unternehmen können Sie Ihre Innovationsstrategien besser verwalten, indem wir Ihnen bei der Entwicklung eines umfassenderen Verständnisses Ihres Wettbewerbsumfelds helfen. Dies ermöglicht Ihnen, die Markttrends vorausschauend zu antizipieren und zu definieren.
Stärkung der Innovationskraft und Planungssicherheit
Ob in der Entwicklung neuer Produktionsverfahren oder der Verbesserung von Maschinen und Anlagen: Die Forschungszulage stärkt die Innovationskraft des Maschinenbaus und schafft langfristige Planungs- und Investitionssicherheit.
Vieler unserer Mandanten im Maschinenbau befinden sich in dieser Transformation und begegnen dort den immensen Herausforderungen. Mit der zusätzlichen Beschaffung von Fördermitteln finden wir eine Antwort auf die Herausforderung des Ressourceneinsatzes.
Zum 1. Januar 2020 hat die Bundesregierung eine neue steuerliche Forschungsförderung, die sogenannte Forschungszulage, eingeführt. Die Förderung ist vor allem auf kleine und mittelständische Unternehmen ausgerichtet, um diese in ihrem Innovationspotential zu unterstützen und somit langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Natürlich profitieren auch größere Unternehmen von der Forschungszulage.
Anspruchsberechtigt sind alle in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen ohne Beschränkung auf Größe, Rechtsform oder Branchenzugehörigkeit, die förderfähige Entwicklungsvorhaben durchführen.
Die Forschungszulage bietet eine maximale Förderung von 2,5 Mio. Euro/Jahr mit Gültigkeit ab Veröffentlichung der Gesetzesänderung am 28.03.2024. Hierbei gilt ein Fördersatz von 25 % (+10 % extra für KMU) auf förderfähige Kosten, insbesondere die Kosten für das Personal, das im Rahmen Ihrer Entwicklungsaktivitäten beschäftigt ist. Die förderfähigen F&E-Kosten sind auf maximal 10 Mio. € pro Jahr gedeckelt. Für Forschung, welche extern in Auftrag gegeben wird, gilt ein Fördersatz von 17,5 % (+7 % extra für KMU).
Die Forschungszulage kann rückwirkend von 2020 bis 2023 beantragt werden sowie planungssicher für 2024. Ihnen winken insgesamt bis zu 4+2.5 Mio. Euro Förderung für Ihre Projekte.
- Neuartig: Es muss auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen.
- Ungewiss: Es müssen Unsicherheiten in Bezug auf das Endergebnis bestehen.
- Planmäßig: Das Vorhaben muss einem Plan folgen und budgetierbar sein.
Die Beantragung und Gewährung sind in zwei Schritte unterteilt. Im ersten Schritt erfolgt die Beantragung der Bescheinigung bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ). Die BSFZ prüft, ob die Kriterien eines begünstigten FuE-Vorhabens erfüllt sind und stellt dem Antragsteller im Anschluss eine Bescheinigung aus.
Im zweiten Schritt erfolgt die Beantragung der Forschungszulage beim zuständigen Finanzamt des Anspruchsberechtigten.
Nach der Festsetzung der Forschungszulage wird diese nicht sofort ausgezahlt, sondern bei der nächsten festgesetzten Einkommens- oder Körperschaftssteuer angerechnet. Dies kann sich auch auf zurückliegende Wirtschaftsjahre beziehen und ist nicht abhängig vom Wirtschaftsjahr, für das die Forschungszulage festgesetzt worden ist.
Ist die festgesetzte Forschungszulage höher als die Einkommens- oder Körperschaftssteuer, dann wird diese als Einkommens- oder Körperschaftssteuererstattung ausgezahlt.
Whitepaper Maschinenbau
Ihr strategischer Vorteil: Laden Sie sich das kostenlose Whitepaper herunter, um mehr über die Schlüssel zur effizienten Finanzierung Ihrer Maschinenbauinnovationen zu erfahren
Das sagen unsere Kunden über uns
Busuttil & Company auch bei komplexen Problemen sehr effizient
Kai Nitzsche, CFO bei der Hako GmbH, erläutert im Video, wie das Team bei Busuttil & Company alle förderfähigen Entwicklungsprojekte identifiziert und gleichzeitig die Compliance Risiken durch ausführliche Projektdokumentationen minimieren hat. Die konzerninterne Abstimmung innerhalb der Possehl-Gruppe ist für die förderfähige Bemessungsgrundlage der Forschungszulage von hoher Bedeutung: Die Obergrenze ist auf 4 Mio Euro pro Wirtschaftsjahr/Konzern festgelegt!
Führende Expertise für die steuerliche Forschungsförderung
Mit seiner umfassenden Erfahrung in puncto steuerliche Forschungsförderung in Großbritannien bei Deloitte ist Dr. Markus Busuttil einer der führenden Experten für die Forschungszulage. Als promovierter Ingenieur hat er die Fähigkeit, mit den F&E-Abteilungen auf Augenhöhe zu kommunizieren, den Forschungscharakter von Projekten zu evaluieren und Fördermittelanträge in einer Form zu formulieren, die die Wahrscheinlichkeit einer Bewilligung erhöht.
+100
Über 100 zufriedene Mandanten
+10
Über zehn Jahre Erfahrung in der
steuerlichen Forschungsförderung
>30 Mio €
Über 30 Mio € Fördermittel in den
letzten zehn Jahren generiert
Die wichtigsten Vorteile der Forschungszulage
Die Förderung durch das Forschungszulagengesetz ist ab dem 01.01.2020 möglich.
Es werden alle Unternehmen ohne Beschränkung auf Größe oder Branchenzugehörigkeit gefördert, die förderfähige Entwicklungsvorhaben durchführen.
Bei der Forschungszulage sind die Chancen auf eine Förderung deutlich größer als bei anderen Programmen. Wir kennen die „neuralgischen“ Punkte des Verfahrens und holen das Optimum für Sie heraus!
1.
Planbarkeit
- Planbare Reduzierung von Entwicklungskosten durch den verankerten Rechtsanspruch
- Weitreichender Planungshorizont
- Kein Wettbewerb um projektbezogene Zuschüsse
2.
Flexibilität
- Beantragung der Förderung im Nachhinein möglich
- Kein verzögerter Projektstart durch das Warten auf eine Förderzusage
- Erleichterte Förderung kleinerer Entwicklungsprojekte
3.
Thematische Offenheit
- Förderung ist thematisch nicht an ein Forschungsgebiet gebunden
- Es besteht keine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit Hochschulen oder KMUs
Ihr direkter Draht zur individuellen Beratung
Sie haben Fragen rund um die Forschungszulage für Ihr Unternehmen? Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen zur Terminabsprache. Gerne beraten wir Sie zu Ihren individuellen Anforderungen.
Forschungszulage aktuell
Verfolgen Sie unsere Fachartikel, mit denen wir die jeweils aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Forschungszulage für Sie einordnen.