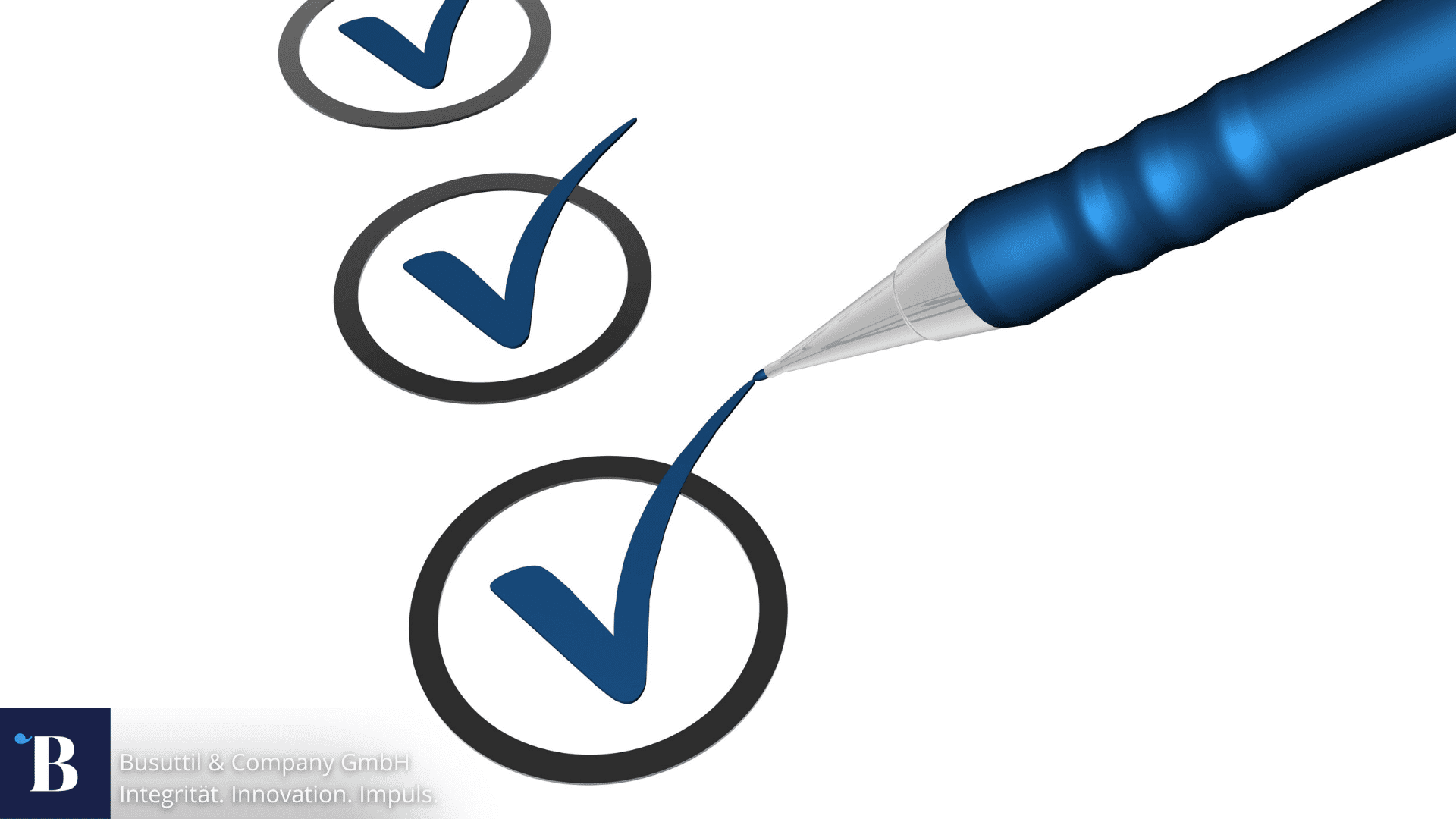
Frascati vs. Praxis: Welche Kriterien zählen bei der Forschungszulage?
Die Beantragung der Forschungszulage ist für Unternehmen ein bedeutender Schritt, der jedoch oft von Verwirrung begleitet wird. Eine zentrale Frage, die viele beschäftigt: Sind es wirklich fünf Kriterien, wie im Frascati Buch angenommen wird, oder sind es nur drei? In diesem Blog-Beitrag werden wir diese Frage klären und Licht ins Dunkel bringen.
Die 3 entscheidenden Kriterien für die Beantragung
Die Forschungszulage bietet Unternehmen die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu erhalten. Laut Forschungszulagengesetz – FZulG des Bundesministeriums der Finanzen müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, um die Förderung in Anspruch nehmen zu können. Im Gegensatz zu den oft zitierten 5 Kriterien des Frascati-Handbuchs gibt es bei der Forschungszulage nur 3 übergeordnete Kriterien:
1. Neuartigkeit der Ziele bzw. Ergebnisse
Das Projekt muss darauf abzielen, neues Wissen zu generieren oder bereits vorhandenes Wissen in neuer Weise anzuwenden. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Neuartigkeit im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik in der Branche des Unternehmens beurteilt wird.
2. Ungewissheit (Risiko)
Es muss zu Beginn des Projekts eine gewisse technische Ungewissheit bestanden haben, d.h. es war nicht klar, ob und mit welchem Aufwand das angestrebte Ergebnis erreicht werden kann.
3. Planmäßigkeit der Umsetzung
Das Projekt muss einem festen Plan folgen, der in Teilschritte gegliedert ist und für den ein Budget erstellt wurde. Die Dokumentation der Ergebnisse ist ebenfalls wichtig.
Die 5 Kriterien des Frascati-Handbuchs
Die oft genannten 5 Kriterien des Frascati-Handbuchs (neuartig, ungewiss, planbar, schöpferisch und reproduzierbar) sind zwar für die Definition von F&E-Tätigkeiten im Allgemeinen relevant, aber für die Forschungszulage gelten nur die oben genannten 3 Kriterien. Die beiden weiteren Kriterien aus dem Handbuch, „Schöpferisches Konzept“ und „Reproduzierbarkeit“, sind bereits in den 3 Kernkriterien enthalten.
- Schöpferisches Konzept: Dieses Kriterium ist bereits in den 3 Kernkriterien enthalten, da ein neues Projekt in der Regel auch ein schöpferisches Konzept erfordert.
- Reproduzierbarkeit: Die Ergebnisse des Projekts müssen so dokumentiert sein, dass sie von anderen Personen nachvollzogen und reproduziert werden können. Auch dies ist in der Regel Teil der Planmäßigkeit der Umsetzung.
Welche Aspekte sind mit den 3 Kriterien gemeint?
Auf den ersten Blick scheinen diese 3 Kriterien durchaus einen hohen Anspruch an die Förderfähigkeit von F&E-Projekten zu stellen. In der genauen Beschreibung dieser Kriterien lässt sich allerdings schnell erkennen, dass diese auch auf kleine Projekte unabhängig der Unternehmensgröße zutreffen. Dabei sind diese Kriterien auch branchenspezifisch zu interpretieren. Im Folgenden klären wir, worauf es bei den 3 Kriterien genau ankommt.
Neuartigkeit
Die Neuartigkeit eines Projektes oder Vorhabens ist gegeben, sobald im Rahmen des Projektes neues Wissen generiert werden konnte. Im Gegensatz zu Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten bezieht sich dieses neue Wissen für Unternehmen allerdings nur auf den aktuellen Erkenntnisstand in der jeweiligen Branche und nicht zwingend auf allgemeingültig neue Erkenntnisse. Dabei müssen die neuen Erkenntnisse auch nicht unbedingt zu einem Produkt oder Verfahren führen, die anderen Produkten oder Verfahren deutlich voraus sind (→ Hierin liegt auch eine Unterscheidung zu vielen anderen Förderprogrammen in Deutschland). Die Lösung oder das Wissen sollten in der Form nur noch nicht branchenweit genutzt worden sein und für das antragstellende Unternehmen selbst neu sein. Dies unterscheidet ein F&E-Projekt im Wesentlichen von Kopien, Nachahmungen und Reversed Engineering.
Es erlaubt Unternehmen auch Projekte fördern zu lassen, die auf Lösungen abzielen, um:
- bestehende Patente mit einem alternativen Ansatz zu umgehen
- Lösungen oder Technologien mit alternativen Ansätzen zu realisieren, die ansonsten durch Konkurrenten geheim gehalten werden oder nicht frei zugänglich sind
- systematisch die Einsatzmöglichkeiten eines Verfahrens oder Prozesses mit dem Ziel neuer Anwendungen oder Einsatzgebiete zu untersuchen
Ungewissheit
Die Ungewissheit stellt wohl das anspruchsvollste Kriterium dar. Hiermit ist insbesondere die Ungewissheit gemeint, ob und mit wie viel wissenschaftlichem (nicht zwingend technischem) Aufwand das Endergebnis erreicht werden kann.
Beispielsweise wird für die Einordnung einer Prototypentwicklung als F&E oder Nicht-F&E insbesondere dieses Kriterium herangezogen. Die Entwicklung eines Prototyps zur Erprobung technischer Modelle und Konzepte hinsichtlich der ungewissen Anwendbarkeit, aber auch zur Ausarbeitung von Produktionsvorschriften, Anleitungen bzw. Handbüchern fällt in die F&E-Definition. Die Entwicklung eines Prototyps zum Erwerb technischer oder rechtlicher Zertifizierungen unterliegt keiner wissenschaftlichen Ungewissheit und würde von der BSFZ ausgeschlossen werden.
Die unklare Finanzierung eines Projektes allein stellt also ohne wissenschaftlichen Bezug keine ausreichende Ungewissheit dar. Folgende Fragen können bei der Einschätzung der Ungewissheit hilfreich sein:
- Stand zu Beginn des Projektes das Ergebnis bereits fest? War es unklar, ob und wie das Ergebnis erreicht werden konnte?
- Gab es Erkenntnisse im Projekt, die vorab nicht offensichtlich waren?
- Existierte ein Risiko, das zum Scheitern führen könnte bzw. waren vorab bereits wissenschaftliche Abbruchkriterien absehbar? (Beispiel: Kann der gewünschte Messwert mit der eingesetzten Sensorik überhaupt oder genau genug erfasst werden?)
- Konnte der Kosten- und Zeitaufwand aufgrund potenzieller wissenschaftlicher Hindernisse, die nicht gängiger Routine entsprechen, vorher nicht präzise abgeschätzt werden?
Planbarkeit
Die notwendige Planbarkeit eines Projektes erfordert einen festen Plan, nachdem sich das Projekt bspw. in Verfahrensschritte untergliedern lässt oder sich (Zwischen-)Ergebnisse dokumentieren lassen. Diesen Etappen lässt sich auch klar abgegrenzt vom übrigen Tagesgeschäft ein Budget zuordnen. Insbesondere bei kleineren Projekten setzt dies aber nicht unbedingt eine umfangreiche Berichterstattung voraus. Es ist bereits ausreichend, wenn bspw. ein Mitarbeiter eine projektbezogene (Teil-)Aufgabe für die Lösung einer Problemstellung erhalten hat und diese dokumentiert wurde. Bspw. grenzt die Systematik als Kriterium F&E-Projekte von reinen Trial-And-Error-Methoden ab.
Für eine Ersteinschätzung ist es dabei hilfreich, sich folgende Fragen zu stellen:
- Gibt es einen Arbeits- oder Ablaufplan zum Projekt? Lässt sich das Projekt in Teilaufgaben bzw. Teilschritte gliedern?
- Kann diesen Teilschritten ein bestimmter Arbeitsaufwand für die Problemlösung zugeordnet werden?
- Kann diesen Teilschritten ein bestimmter Zweck und eine Finanzierungsquelle zugeordnet werden?
- Wurde diese Zuweisung in einer bestimmten Art und Weise dokumentiert?
Abgrenzungen
Um Tätigkeiten von begünstigten Forschungs- und Entwicklungsprojekten abzugrenzen, werden solche identifiziert, die der Marktentwicklung dienen oder darauf abzielen, das reibungslose Funktionieren des Produktionssystems sicherzustellen (gemäß § 2 Absatz 2 FZulG). Ebenso werden Aktivitäten, die zwar Teil des Innovationsprozesses sind, jedoch nicht die oben genannten Kriterien für Forschung und Entwicklung erfüllen, von begünstigten Vorhaben unterschieden. In der Regel fallen entsprechende Projekte oder Arbeitspakete in Vorhaben nicht unter die Kategorie Forschung oder experimentelle Entwicklung.
Darüber hinaus gibt es nach dem FzulG auch Abgrenzungen zwischen geförderter F&E, Innovation und sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Gegenstand | Einordnung | Bemerkungen |
| Prototypen | F&E | Solange das Hauptziel in der Erarbeitung weiterer Verbesserungen liegt. |
| Versuchanlage | F&E | Solange der Hauptzweck F&E ist. |
| Produktdesign | Im Einzelfall zu prüfen / ggf. teilweise | Das in der F&E-Phase benötigte Produktdesign ist einzubeziehen. Das Produktdesign für den Produktionsprozess ist auszuschließen. |
| Industrial Engineering und Werkzeugeinrichtung | Im Einzelfall zu prüfen / ggf. teilweise | „Feedback“-FuE und die erforderliche Werkzeugeinrichtung sind in Innovationsprozesse bzw. F&E-Tätigkeiten einzubeziehen. Erfolgen sie für Produktionsprozesse, sind sie auszuschließen. |
| Versuchsproduktion | Im Einzelfall zu prüfen / ggf. teilweise | Einzubeziehen, falls die Produktion Serientests und in der Folge weitere Konzipierungs- und Ingenieurarbeiten ergibt. Alle anderen verbundenen Aktivitäten sind auszuschließen. U. a. dann Ausschluss, sobald eine Versuchsanlage als normale kommerzielle Produktionseinheit dient. |
| Vorserienentwicklung | keine F&E | Ausnahme sog. „Feedback“-F&E (die als F&E einzubeziehen ist). |
| Kundendienst und Beseitigung von Störungen nach dem Verkauf | keine F&E | |
| Patent- und Lizenzarbeiten | Im Einzelfall zu prüfen / ggf. teilweise | Alle verwaltungstechnischen und rechtlichen Schritte, die für die Beantragung von Patenten und Lizenzen erforderlich sind, sind keine F&E. Dagegen sind Patentarbeiten in direkter Verbindung mit F&E-Projekten einschließlich der Dokumentation von F&E-Projekten F&E. |
| Routineuntersuchungen | keine F&E | Selbst wenn sie von F&E-Personal durchgeführt werden. |
Tabelle 2.3 aus dem BFM-Schreiben von 2023-02-07, Seite 14.
Fazit
Insgesamt sind die Interpretation und Anwendung der drei F&E-Kriterien für viele Unternehmen eine komplexe und herausfordernde Aufgabe. Die Unklarheiten und Grauzonen, die mit diesen Kriterien verbunden sind, können dazu führen, dass Unternehmen unsicher sind, ob ihre Projekte förderfähig sind oder nicht. Eine klare Kommunikation und Richtlinien seitens der Förderstellen sowie eine umfassende Beratung durch Fachexperten können Unternehmen dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu bewältigen und ihre F&E-Projekte erfolgreich zu beantragen.
Beratung mit Auszeichnung: Innovative Ideen brauchen starke Partner
Seit dem vergangenen Freitag ist es offiziell: Busuttil & Company gehört zu den besten Mittelstandsberatern.
Rückenwind für Innovationen: Bundesregierung plant Verbesserung der Forschungszulage 2026 durch steuerliches Investitionsprogramm
Im Koalitionsvertrag wurde es bereits angekündigt, wenige Wochen später liegt der erste Gesetzesentwurf vor. Im Rahmen eines Investitionssofortprogramms plant die Bundesregierung eine erneute Verbesserung der Forschungszulage 2026.
Pride Month 2025: Vielfalt im Unternehmen ist mehr als ein Statement
Pride Month heißt zuhören, sichtbar machen, Verantwortung übernehmen. Wie wir bei Busuttil & Company Vielfalt leben – an jedem Tag im Jahr.



