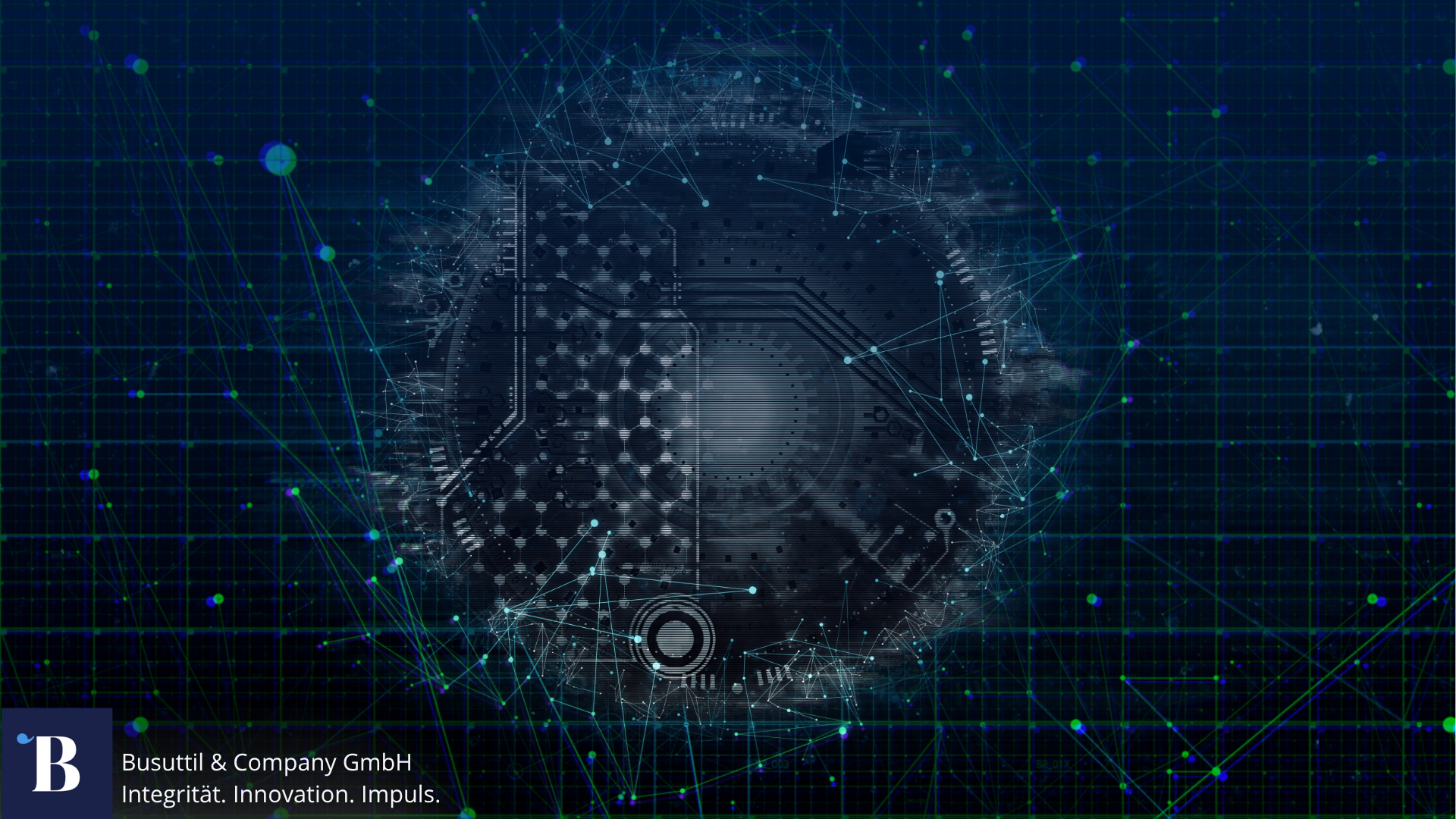Mehr Investitionssicherheit für Software-Entwicklung – mit der Forschungszulage
Die digitale Transformation ist das Thema unserer Zeit. Neue digitale Geschäftsmodelle bereichern den Einzelhandel, Kryptowährungen ergänzen den Finanzmarkt, das IoT revolutioniert industrielle Produktionsprozesse. Will der Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbsfähig bleiben, gilt es, echte Innovationen in immer kürzeren Entwicklungszyklen hervorzubringen.
Aber mit der zunehmenden Digitalisierung verzeichnet auch die kriminelle Energie einen sprunghaften Anstieg. 144 Millionen neue Schadprogramm-Varianten hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für das Jahr 2021 gezählt. Eine Steigerung um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und auch die Qualität der Angriffe ist dramatisch gestiegen. Die Arbeit aus dem Homeoffice schafft zum Teil beste Bedingungen für Wirtschaftsspionage. Cyber Security ist damit das zweite essenzielle Thema für jedes Unternehmen.
In vielen Unternehmen ist Krisenmodus angesagt. Auch in der IT-Branche, sei es durch Fachkräftemangel oder den gestiegenen Cyberangriffe. Die konjunkturelle Unsicherheit bremsen den Innovationsschub in deutschen Unternehmen und Beeinträchtigen durch den schwindenden finanziellen Spielraum auch den Fortschritt vieler Entwicklungsprojekte. Dabei ist kontinuierliche Innovation entscheidend für das Gelingen der digitalen Transformation.
Doch wie können IT-Unternehmen den Spagat zwischen Entwicklungsarbeit und ökonomischer Sicherheit meistern? Ein neues Instrument kann Abhilfe schaffen: die Forschungszulage.
Die digitale Transformation – trotz Krisen
Ohne die Bereitschaft der IT-Branche, Hard- und Software für die Aufgabenstellungen der Zukunft weiter oder neu zu entwickeln, wird die digitale Transformation in Konzernen und mittelständischen Unternehmen nicht gelingen. Mit den steigenden Erwartungen von Kunden steigen auch die Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeiten, denn Konzerne und Mittelstand lagern ihre Probleme an die IT-Branche aus. Für IT-Unternehmer ist die Investition in risikobehaftete Entwicklungen durch das komplexe Wirtschaftsklima schwierig. Selbst die vom Wachstum verwöhnte Tech-Startup Szene macht durch Stellenstreichungen und geplatzte Finanzierungsrunden auf sich aufmerksam.
Lesen Sie auch über Forschungszulagen für IoT-Entwicklung in einem unserer Artikel.
Wie kann man die Investitionen in Entwicklungsvorhaben und -projekte aufrechterhalten?
Ein Lösungsansatz: die steuerliche Forschungsförderung.
Ein recht neues Instrument der Innovationsförderung ist die sogenannte Forschungszulage, eine steuerliche Förderung, die entwickelnde Unternehmen beantragen können. 25 Prozent der förderfähigen Kosten können geltend gemacht werden. Die Förderung ist bei einer Million Euro pro Jahr gekappt, kann aber rückwirkend für 2020 & 2021 beantragt werden! Die Forschungszulage ist in den meisten Unternehmen noch relativ unbekannt. Das Expertenteam für steuerliche Forschungsförderung bei Busuttil & Company hat bereits viele Software-Entwicklungsprojekte in mittelständischen und Großunternehmen durch die Antragstellung begleitet. Die Zulage hat viele Vorteile. Zum Beispiel die Breite an Entwicklungstätigkeiten, die förderfähig sind. Aus unserer Beratung wissen wir, dass viele Entwicklungsleiter glauben, die Hürden seien viel zu hoch. Doch das Gegenteil ist oft der Fall. Gerade im Bereich der Softwareentwicklungen sind die Chancen auf Förderung besonders gut – sofern es um Lösungen geht, die nur mit einem gewissen Risiko entwickelt werden können.
Staatliche Förderung zur Abfederung der Entwicklungskosten – Forschungszulage für Software-Entwicklung
Die Forschungszulage kann in Krisenzeiten helfen, das Tempo in Forschung und Entwicklung aufrecht zu halten. Ein wichtiges Kriterium, um die Forschungszulage nutzen zu können, ist die Beurteilung des technischen Risikos. Denn das Besondere der Forschungszulage ist, dass es gerade Projekte mit einem technischen Entwicklungsrisiko fördert. Softwareentwicklungen mit Hilfe routinemäßiger Methoden, wie der einfachen Implementierung von Standardlösungen, etablierten Applikationen, Bibliotheken oder Protokollen, die zudem im Ergebnis klar sind, haben weniger Aussicht auf eine Förderung. Anders sieht es aus, wenn die Anforderungen an eine Lösung hoch sind und Routineansätze nicht weiterhelfen. Zum Beispiel sehen wir auf der Architektur- oder Integrationsebene sehr häufig förderwürdige Entwicklungen. In diesem Bereich führen die ursprünglichen Annahmen häufig nicht zum gewünschten Ergebnis oder zu einem unvorhersehbaren Systemverhalten wie z.B. hohen Latenzzeiten und anderen Performanceproblemen. Das kann dann Fragen z.B. nach Datenmodellen und ähnlichen Faktoren aufwerfen.
Besonders komplex wird es in Cloudumgebungen, wo die Rechenkapazität zwar unendlich skalierbar, jedoch nicht immer wirtschaftlich tragbar ist. Dazu kommen noch die gestiegenen Anforderungen im Hinblick auf Cyber Security und Datenschutz“, umreißt Dr. Busuttil das Entwicklungsfeld. Kurz: Immer, wenn Routinelösungen wegen hoher Anforderungen nicht greifen und zur Lösung „um die Ecke gedacht“ werden muss, ist ein Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit förderfähig. So wird die Forschungszulage für Software-Entwicklung relativ häufig vergeben.
Hohe Innovationsquote schafft Standortsicherheit
Die Forschungszulage ist eines von mehreren Instrumenten der Innovationsförderung, die seit vielen Jahren vorangetrieben wird. Seit 2005 haben sich die Ausgaben des Bundes für Forschung und Entwicklung von 9 Milliarden Euro auf 18,7 Milliarden Euro im Jahr 2019 mehr als verdoppelt. Und auch die Wirtschaft hat ihren Einsatz erhöht: Die FuE-Ausgaben stiegen kontinuierlich, allein von 2018 auf 2019 um 5,2 Prozent. 91,3 Milliarden Euro steckten Unternehmen 2019 in eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Diese umfangreiche Investition ist notwendig, um Deutschland langfristig als Wirtschaftsstandort weltweit konkurrenzfähig zu halten.
Allein mit der Forschungszulage lassen sich förderfähige Entwicklungskosten systematisch und verlässlich um 25 Prozent reduzieren. Das gibt Unternehmen den Spielraum, die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auszubauen, anstatt Projekte in Nearshore- oder Offshore-Länder auszulagern. Das ist ein erheblicher Beitrag zur Standortsicherheit. Zudem ist sie wesentlich offener, flexibler und planbarer für Unternehmen als viele andere Fördermöglichkeiten.
Das Instrument verspricht Erfolg, wenn es denn von Unternehmen – vor allem aus der IT-Branche – genutzt wird. Hier sieht das Expertenteam bei Busuttil & Company noch viel Potenzial: Technologische Expertise ist gerade im digitalen Bereich absolut entscheidend. Für Start-ups genauso wie für etablierte Unternehmen. Hier kann die Forschungszulage einen echten Mehrwert schaffen. Und mit der sicheren Durchführung des Entwicklungsprojekts ist das Risiko der Mittelrückforderung extrem gering.
Die Forschungszulage scheint genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen zu sein. Sie bietet vielen Unternehmen, die Softwareprojekte entwickeln, die Möglichkeit, sich für die Zukunft gut aufzustellen und den Entwicklungsstandort Deutschland zu sichern. Im Angesicht der diversen aktuellen Krisen eine echte Chance, proaktiv und effektiv zu handeln.
Wir helfen Ihnen dabei, alle förderfähigen Software-Projekte Ihres Unternehmens zu identifizieren und unterstützen Sie auf allen Ebenen des Antragsverfahrens. Gerne beraten wir Sie individuell in einem persönlichen Gespräch:
Mehr Förderung ab 2026: Was das neue Investitionssofortprogramm für die Forschungszulage bedeutet
Was im Koalitionsvertrag angekündigt wurde ist nun gesetzlich verankert: Mit dem Investitionssofortprogramm hat die Bundesregierung die Forschungszulage reformiert. Ab dem 1. Januar 2026 gelten höhere Fördersätze und neue steuerliche Anreize für innovative Unternehmen.
5 Jahre Busuttil & Company = 5 Jahre Forschungszulage: Gemeinsam gewachsen, gemeinsam gereift
Vor 5 Jahren starteten Busuttil & Company und die Forschungszulage gemeinsam in eine neue Ära der Innovationsförderung. Aus einer Vision wurde ein über 20-köpfiges Expertenteam, das heute über 100 Projekte aus verschiedensten Branchen begleitet und die Zukunft der Forschungsförderung aktiv mitgestaltet.
Einheitliche Innovationsförderung statt Doppelstrukturen: Politische Weiterentwicklung der Forschungszulage
Deutschland braucht eine moderne Innovationsförderung ohne Doppelstrukturen. Statt ZIM und Forschungszulage parallel zu führen, fordern wir ein zentrales Förderinstrument: die Transformationszulage.